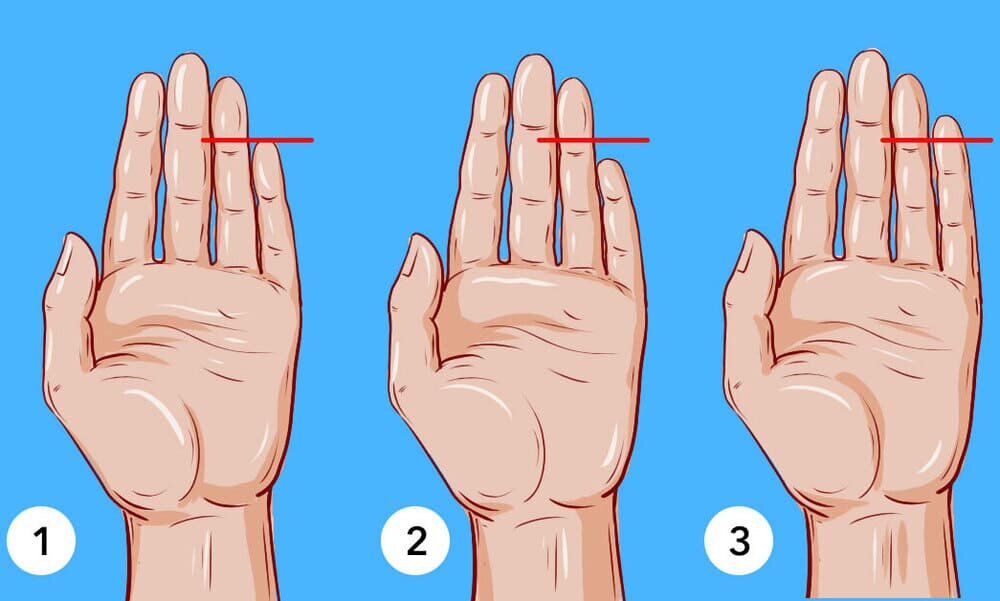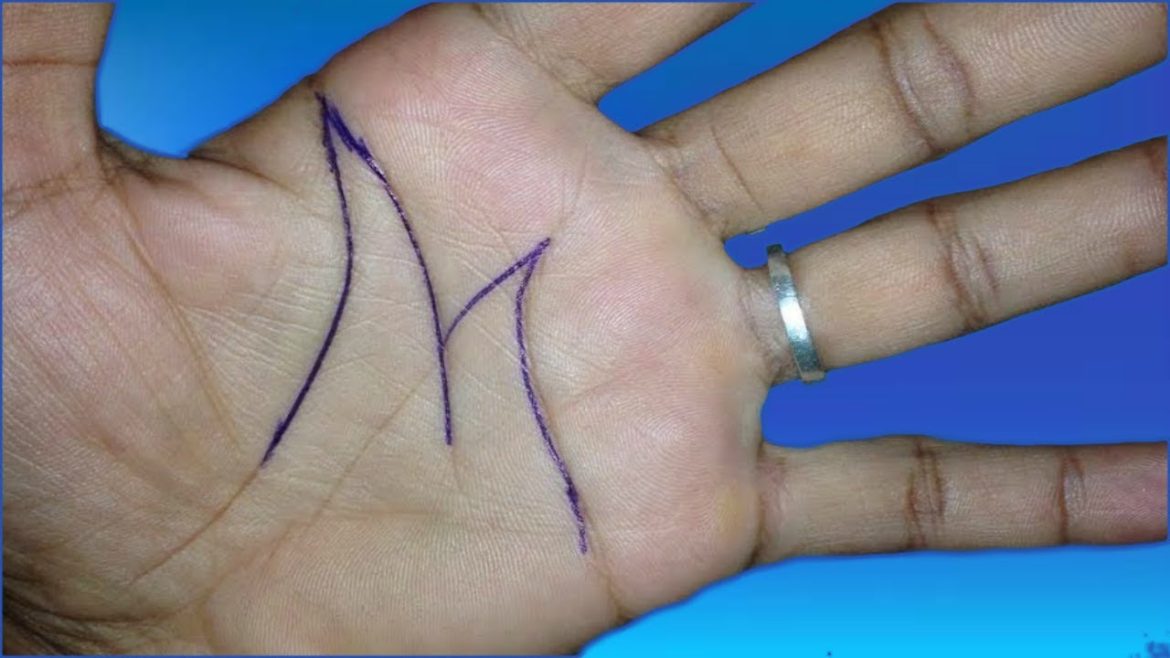Im ARD-Sommerinterview konnten sich Interviewer Markus Preiß und AfD-Chefin Alice Weidel teils kaum verstehen. Das Interview fand wie üblich im Freien im Berliner Regierungsviertel statt – das nutzten Demonstranten, um das Gespräch mit Trillerpfeifen, Hupen und Anti-AfD-Gesängen zu stören.
“Das war ein Interview, was unter verschärften Bedingungen, um es mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen, stattgefunden hat“, sagte Preiß im Anschluss. Im WDR-Interview beschreibt Politikwissenschaftler Oliver Lembcke, Professor an der Ruhr-Universität Bochum, wie er das Interview wahrgenommen hat.
WDR: Das war ja keine einfache Situation für alle Beteiligten. Wie ist denn Alice Weidel aus Ihrer Sicht damit umgegangen?
WDR: Hat Alice Weidel die Situation im Laufe des Interviews dann auch für sich genutzt? Sie hat ja zum Beispiel öfter mal darum gebeten, ausreden zu dürfen, weil sie eine Zwischenfrage nicht gehört hat.
Lembcke: Ja, das kennen wir von ihr, das ist ein typisches Verhalten. Ehrlich gesagt unter Politikern generell, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Sie ist dann sicherer geworden in dem Gespräch. Das hatte auch damit zu tun, dass natürlich auf der anderen Seite nicht so richtig scharf nachgefragt werden konnte.
WDR: Was hat Alice Weidel denn aus Ihrer Sicht inhaltlich angeboten?
Lembcke: Wenig Neues. Also ich bin doch immer wieder ein bisschen erstaunt, mit wie viel Bekanntem und auch Unfug man durchkommen kann. Weidel bleibt im Wahlkampfmodus. Sie bleibt im Prinzip dabei, komplette Realitätsverweigerung zu betreiben, was man ja schon von dem Wahlprogramm der AfD kannte. Und auch auf Nachfragen – die waren zum Teil ganz gut informiert, zum Teil hätte man da, glaube ich, auch noch deutlich schärfer nachfassen können – erzählt sie das, was man von der AfD kennt.
Ein Beispiel: Sie hat, wenn es um die sozialen Sicherungssysteme geht, nur wenig anzubieten außer dem bekannten Hinweis auf die Migration. Sie lässt sich und ihre Partei eigentlich schwach aussehen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die AfD ein Problem mit Zahlen und Zusammenhängen hat. Und das wurde in dem Interview trotz dieser lautstarken Kulisse schon punktuell deutlich, kann man aber noch einmal ganz klar stärker herausarbeiten.
WDR: Wie sehr guckt Alice Weidel nach Ihrer Einschätzung in so einem Interview auf Wählerinnen und Wähler, die vielleicht noch unentschlossen sind, die AfD zu wählen? Und wie sehr guckt sie auf ihr Kernklientel?
Lembcke: Also bei einem solchen Interview, glaube ich, guckt sie nicht nur auf ihr Kernklientel, sondern auch darauf, wie sich das in den sozialen Medien verwerten lässt. Sie gibt Antworten, von denen sie genau weiß, dass sie gar nicht eigentlich überzeugen muss, sondern dass es ausreicht, bestimmte Schlagworte zu produzieren, die dann ihrerseits ein Eigenleben im Internet verbreiten können. Und das ist auch so ein bisschen das Problem.
Auf der anderen Seite sollte man nicht locker lassen. Man sollte versuchen, diese ungenügenden Aussagen und die Programmlosigkeit, die von ihr ausgeatmet wird, immer wieder klar und fest zu benennen – und auch deutlich zu machen, wo es eigentlich aufhört. Und es hört sehr schnell auf bei der AfD. Und deswegen sind solche Gespräche – auch wenn sie natürlich einen Preis haben, nämlich den Preis einer Normalisierung – ein sinnvolles Instrument, um sich inhaltlich mit der AfD auseinanderzusetzen.
WDR: Als Weidel am Ende gefragt wird, ob sie drei Dinge nennen kann, die in Deutschland gut laufen, ist ihr nichts eingefallen, außer dass sie stolz auf die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist. Geht diese Strategie des Schlechtredens für die AfD weiter auf?
Lembcke: Die geht dann auf, wenn es in Deutschland schlecht mit der Politik weitergeht. Wenn die Politik zeigen kann, dass sie handlungsfähig ist und lösungsorientiert Probleme löst, dann erschöpft sich das auch irgendwann einmal.